|
ideologiekritik in wilhelm buschs "eduards traum" |
|
|
Die Berechtigung einer Untersuchung nach dem ideologiekritischen Gehalt von Wilhelm Buschs Eduards Traum (1891) mag auf den ersten Blick fragwürdig erscheinen. Handelt es sich doch um eine bizarre Erzählung, die zum großen Teil in phantastischen Gegenden spielt und deren Darstellung der sogenannten 'gewöhnlichen' Welt alles eher denn real anmutet. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass vieles von dem Fabelhaft-Grotesken, dem Sinnlos-Drolligen in Wirklichkeit nur eine Einkleidung für Buschs Kritik an einer mangelhaften Welt ist. Die Satire klagt ja nicht offen an wie das Pamphlet, sondern kritisiert auf den Umwegen der Ironie und der spöttischen Übertreibung. In der vorliegenden Erzählung ist die Kritik freilich sehr warm eingepackt: Neben dem phantastischen Aspekt, der durch den Traum legitimiert wird, wären noch der aussöhnende Humor, der allegorische Charakter des letzten Teiles (193ff.)* und die Abwesenheit jedes – wenigstens direkten – Hinweises auf das Zeitgeschehen zu erwähnen. Außerdem sichert sich Busch vor dem Lesepublikum ab, indem er einen gewissen Freund Eduard den Traum erzählen lässt (eine Tatsache, auf die er während des Traumberichts noch öfters hinweist). Darüber hinaus distanziert er sich verstimmt von der Traumerzählung – wenn dies auch nur ironisch gemeint ist. Damit haben wir ein zweites Merkmal der Erzählung gestreift: die Doppeldeutigkeit der Aussage. Sie sei an einem Beispiel verdeutlicht, das zugleich die Funktion der Traumeinkleidung deutlich macht. |
|
|
|
| Dieser Abschnitt ermöglicht eine
Doppellektüre. Buchstäblich gibt er eine Klage wieder über Menschen, die darauf aus
sind, anderen ihre völlig bedeutungslosen Träume zu erzählen. Die Tatsache aber, dass
Busch selbst in diesem Prosawerk nichts anderes macht als einen Traum zu erzählen, lässt
uns diese Lesart verdächtig vorkommen. Wir interpretieren den Satz ironisch, und somit
verkehrt er sich in sein Gegenteil: Die Träume werden wieder zu Ehren gebracht, weil sie
"Belustigungen in der Kinder- und Bedientenstube des Gehirns, nachdem der Vater und
Hausherr zu Bette gegangen" sind, d.h. weil sie die Möglichkeit zu freier
Meinungsäußerung bieten, die sonst durch die Herrschenden unterdrückt wird. Der Traum
hat also eine doppelte Funktion: Einerseits kleidet er die Kritik ein, ja verhüllt und
entkräftet er sie; andererseits verleiht er Busch überhaupt erst die Möglichkeit,
Kritik zu üben. Formelhaft ausgedrückt: Busch braucht eine Maske, um er selbst sein zu
können. Aus dem Beispiel geht hervor, wie wichtig die Unterscheidung zwischen manifestem
und latentem Inhalt der Aussagen gerade zur Aufdeckung der eingekleideten Ideologiekritik
ist. In unserem Beispiel gibt der manifeste Gehalt die bürgerliche Meinung wieder, die
aber, wie sich aus dem latenten Gehalt ergibt, kritisiert wird. Exemplarisch für das Spiel mit Doppeldeutigkeit in Eduards Traum ist die Eduard-Gestalt selber. Eduard ist der eigentliche Erzähler des Traumes und als solcher Buschs Medium für manche kritische Äußerung. Er ist es, der - durch seine Einschrumpfung zum 'denkenden Punkt' von der Schwerkraft befreit - alle Gegenden durchstreifen und Einsicht in die wahre Beschaffenheit vieler Dinge gewinnen kann. Derselbe Eduard aber erscheint im Alltagsleben als rechter Spießbürger, ein braver Hausvater, der, nachdem Frau Elise und der kleine Emil zu Bett gegangen sind, noch 'behaglich (!) grübelnd' bei Havanna und Abendtrunk den weiteren Abend im Sessel zu verbringen pflegt. Kritiker und Bürger treffen sich also in einer Person. Folglich ist Eduard bald direkt, bald indirekt das Sprachrohr Wilhelm Buschs. Denn auch als 'denkender Punkt' haftet Eduard manches Bürgerliche an, man denke nur an seine Selbstgefälligkeit. An solchen Stellen ist eine Lektüre des latenten Gehalts geboten. Wir haben dem Aspekt der Doppeldeutigkeit u.a. deshalb soviel Aufmerksamkeit gewidmet, weil man ihn im Folgenden immer vor Augen halten soll. Beim Herausfinden der Objekte der Kritik musste ja ständig geprüft werden, ob diese oder jene Aussage ironisch oder nicht aufzufassen war. Entscheidend in solchen Zweifelsfällen, wie eigentlich für die ganze Arbeit, war ein außertextliches Kriterium: die Frage, ob eine bestimmte Aussage mit Buschs kritischen Ansichten (wie sie zu unseren Vorkenntnissen gehören) in Einklang gebracht werden konnte. Dabei liegt zwar die Gefahr nahe, dass die Möglichkeit einer gehaltlichen Eigenart, einer Abweichung bestimmter Ideen in diesem 1890 geschriebenen Werk verkannt wird; dieses dem hermeneutischen Prozess weniger oder mehr innewohnende Übel ist aber mit in Kauf zu nehmen. Wie gesagt, finden sich in Eduards Traum keine offenen Anspielungen auf bestimmte politische Ereignisse; im Traum werden Zeit und Raum ja aufgehoben (vgl. 160), und eine derartige direkte Zeitbezogenheit wäre auch mit Buschs Natur als Autor in Widerstreit. Von einer politischen Satire kann in bezug auf diese Erzählung nicht die Rede sein. Auch der Begriff 'Sozialkritik' trifft, wie später noch zu erörtern sein wird, nicht zu; die Fülle der dargestellten Lebensbereiche übersteigt jedenfalls das Gesellschaftliche. Kritisiert wird vielmehr die Gesamtheit der in Buschs Zeit herrschenden Anschauungen, Werte und Normen, d.h.: die bürgerliche Ideologie der Gründerzeit. Im Folgenden wollen wir versuchen, stichwortartig die wichtigsten kritisierten Ideologeme aufzuführen. Das Strebertum Die aufeinanderfolgende Darstellung der ein-, zwei- und dreidimensionalen Welt hat Busch für eine vortreffliche Verspotttung des karrieresüchtigen Menschen ausgenutzt. Der Streber wird anhand des winzigen mathematischen Punktes exemplifiziert, dem Eduard zum ersten Mal als schüchternem Tänzer im Tanzzelt begegnet (164). Wenn Eduard der geometrischen Ebene zustrebt, folgt ihm das Pünktchen, das sich darüber beklagt, dass es es "zu Hause doch zu nichts brächte. Nun wollte er mal sehn, ob dort drunten in der geometrischen Ebene für ihn nichts zu machen sei" (165). Später, im dreidimensionalen Raum, trifft Eduard den fast unkenntlich gewordenen Punkt, "der so rund und dick geworden war, dass er die ganze Tür versperrte", wieder. |
|
|
|
| Das Wort 'materialisieren' spricht
Bände in diesem Zusammenhang: Der strebende Punkt (sprich: 'Mensch'), der doch
grundsätzlich ein ideelles Wesen (sogar 'rein gedacht' und 'nur mathematisch') war, ist
seine Eigenart preiszugeben bereit, wenn das nur seiner Karriere zugute kommen kann.
Bemerkenswert ist die Weise, in der Busch - durch Eduards Mund - dem phantastischen
Einzelfall Allgemeingültigkeit verleiht und zugleich die Verbindung zwischen fiktiver und
reeller Welt darstellt: |
|
|
|
Im ersten Satz wird über den Punkt
schon völlig in menschlichen Termini gesprochen; mit dem Nebensatz über 'alle
seinesgleichen' fallen fiktive und Realwelt zusammen. 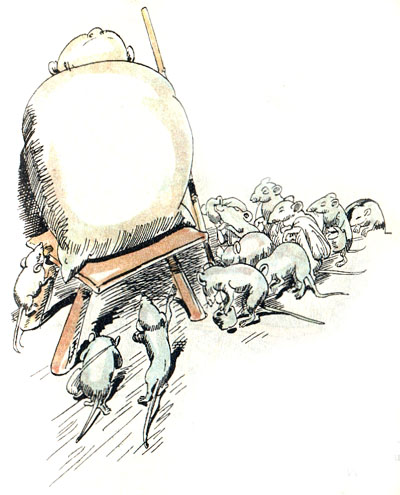 Eine ähnliche Kritik an den gesellschaftlichen Emporkömmlingen, diesmal in der Menschenwelt situiert, bildet die Beschreibung eines Dialogs im Bauernhaus. |
|
|
|
| Die ungewollt aus ihrer neuen Rolle
fallende Bauerntochter illustriert die Lächerlichkeit, wozu Streberei, die den früheren
Status abzuwerfen versucht, führen kann. Eduard gibt den ironischen Kommentar: "Ein
erfreuliches Beispiel frisch aufblühender Bildungsverhältnisse, die noch etwas von dem
kräftigen Dufte des humushaltigen Erdreichs an sich haben, worauf sie gewachsen
sind." (173) Geschäftstüchtigkeit und Materialismus Die in Eduards Traum dargestellten Arbeitsformen haben fast alle mit dem Bereich der Wirtschaft zu tun, ja, die Wirtschaft scheint das ganze Tun und Lassen der Menschen zu bestimmen. Diese Tatsache weist auf die enge Verknüpfung dieser phantastischen Erzählung mit dem Geist der Gründerzeit hin, die wohl vor allem durch das Gewinn- und Erfolgsdenken geprägt war. Der Materialismus als Triebfeder nicht nur der menschlichen Handlungen, sondern sogar der menschlichen Gefühle wird in der Szene mit der durch Inkompetenz des Arztes gestorbenen Bäuerin angeprangert. Dort heißt es: "Der Bauer war untröstlich; denn das Honorar betrug 53 Mk. 75 Pf." (171) Nicht der Tod der Ehefrau, sondern der Verlust einer Summe Geld verursacht das Leid des Bauern. Wenn derselbe Bauer ein wenig später bemerkt, dass er noch dreizehn Ferkel 'à Stück 22 Mk.' besitzt, ist er bald 'ein neuer Mensch'! Der bürgerliche hohe Wert der Geschäftstüchtigkeit wird unbedingt als verkappter Betrug entlarvt, und das sowohl im Bereich der Produktion wie in dem der Distribution und der Finanz. |
|
|
|
| Typisch ist der Zusammenhang, der in
beiden Abschnitten zwischen von der Gesellschaft allgemein honorierten Tugenden und den
bösen Zwecken, denen sie dienen, hergestellt wird. Auch die Vertreter von Gericht und
Beamtentum, die ein wachsames Auge auf das ganze Geschäftswesen behalten sollen,
unterliegen dem egoistischen Besitzdrang (vgl. das Reich der Zahlen 162f.). Der Antisemitismus Im Zusammenhang mit der kapitalistischen Gewinnsucht gab es in Buschs Zeit einen Hass auf die Juden, die u.a. als zu starke Konkurrenten betrachtet wurden. Dieses Ideologem findet in Eduards Traum seinen Niederschlag in einem Abschnitt, der mit dem vielbedeutenden Satz "Das Geschäft steht in Blüte, der Israelit gleichfalls" anfängt (177). Nun ist diese Stelle, die Eduard in den Mund gelegt wird, offenbar nicht ironisch, sondern wirklich buchstäblich aufzufassen. Man könnte daher auf eine Übernahme der antisemitischen Gesinnung durch Busch schließen. Dem widersprechen aber zwei Punkte: Erstens wird eigentlich nur die Tatsache verspottet, dass die Juden noch mehr für das Geschäft übrig haben als die anderen Leute; Busch tadelt nur die auf die Spitze getriebenen 'bürgerlichen Tugenden' (sprich: ihre Geldsucht und ihren Materialismus). Zweitens ist der Abschnitt über den Israeliten einem über das Haus eines 'antisemitischen Bauunternehmers' nachgestellt. Und hier ist plötzlich vollauf von einer Unmenge von Lastern die Rede: Vergiftungsversuch, Ehestreit, Diebstahl, Hass und Betrug bevölkern die Etage der Mietskaserne.  Bei der Beschreibung eines unglücklichen Fallschirmspringers, der hinunterfällt, wird der Antisemitismus deutlich ironisiert. |
|
|
|
| Dass trotzdem von einer gewissen
ambivalenten Haltung Buschs den Juden gegenüber gesprochen werden muss, belegt m.E. eine
dritte Stelle, wo Eduard den Figuren des Tierkreises begegnet: "Nicht weit davon in
seiner Butike saß der schlaue krummnasige 'Wassermann' – Juden gibt's doch allerwärts!
– und regulierte die 'Waage' zu seinen Gunsten." (184) Der zwischengeschobene Satz ist
offenbar ironisch gemeint, er hebt jedoch die Aussage des Hauptsatzes nicht auf. Der Rousseauismus Die Sehnsucht des industrialisierten 19. Jahrhunderts nach der 'ländlichen Reinheit' hat in Eduards Traum viel zu erdulden. Die (schön parodierte) Idylle wird gründlich zerstört in der Beschreibung des 'freundlichen Dörfchens' (170-175), das sich bei genauem Hinsehen als Schauplatz von Streitsucht, Grausamkeit, Aggressivität, Geldgier, Herzlosigkeit, Dummheit und Betrug herausstellt. Die Idee des 'ursprünglich guten Menschen' erweist sich nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Ehe als Fiktion. Von den vielen geschilderten Ehen ist keine einzige glücklich zu nennen, wohl im Gegenteil. Der Gegensatz Stadt/Land spielt dabei keine Rolle. Von einem besonnenen Hausvater auf dem Lande heißt es: "Dieser Vater, so scheint es, hatte bereits den Gipfel der ehelichen Zärtlichkeit erklommen, wo die Schneeregion anfängt." (172) In der Stadt geht das eheliche Zusammenleben so zu: |
|
|
|
| Das alles veranlasst Eduard dazu, zu
bedenken, dass ihm "ein wahrhaft guter Mensch" noch nicht vorgekommen sei. Er
wird auf einen 'Menschenfreund' aufmerksam gemacht, "dem der Besitz eine Last sei und
das Verteilen ein Bedürfnis" (182). Bei einem Besuch zeigt sich aber, dass auch
dieser Mensch, von der Schlechtigkeit seiner Mitmenschen bedrängt, "doch kein recht
guter Mensch war." Die anti-rousseauistische Kritik wird noch dadurch gesteigert, dass
Eduard in Gestalt eines philantropischen Reichen, der seine (anderthalb Mark schwere)
'Freigebigkeit' beklagt, "sogar einen mehr als guten Menschen" erkennt. Die bürgerliche Moral Wir haben gesehen, wie Busch den Glauben an den 'guten Menschen' in den Grundfesten erschüttert hat. Wenn einige Figuren in der Erzählung sich trotzdem auf Moralisches berufen, so liegt es nahe, dass dies als Doppelmoral entlarvt wird. Der Widerspruch zwischen Worten und Taten wird an der Vorführung des 'bescheidenen Wandersmanns' im Wirtshaus (notabene wieder auf dem Lande) klargemacht. |
|
|
|
| Im Kunstverein der Stadt läuft ein Prinzipienreiter der Sittlichkeit herum: | |
|
|
| Am deutlichsten wird die wirkliche Funktion einer solchen Moral in Eduards (ironische) Kommentar zum Verhalten des Besen- und Rutenbinders auf der Landstraße enthüllt. Der Ton dieser Geschichte ist übrigens zugleich eine Parodie auf das idyllische Bild vom einfachen aber weisen Landmann. Der Handwerker findet den vom Arzt verlorenen Geldbeutel und steckt ihn sofort in die Tasche. Wenn der Doktor ihn ein wenig später fragt, ob nichts gefunden sei, antwortet der Landmann 'mit überzeugender Miene' verneinend. | |
|
|
| Die Moral, die das Handeln des
Menschen bestimmen soll, erscheint hier als Rechtfertigung des schlechten Handelns post
factum, als ein Beschönigen der wirklichen Motive (nämlich Egoismus) mit falschen
Worten, eine Erscheinung, für die die Psychoanalyse den Terminus 'Rationalisierung'
bereithält. Der Konventionalismus und die Heuchelei, die die Folgen einer solchen Moral sind, werden an den hohlen Bewohnern der dreidimensionalen Welt vorgeführt: |
|
|
|
| In der Menschenwelt findet diese
Erscheinung im hohen Salonleben ihr Pendant, wo der 'alte Adam' und Eva, sobald sie 'was
auf die hohe Kante gelegt' haben, die Spuren ihrer sündigen Vergangenheit so zu
verhüllen wissen, "dass man kaum noch sieht, was eigentlich dran ist" (179). Die Industriegesellschaft Die Folgen der Industrialisierung, die im Deutschland der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts großen Aufschwung nahm, werden von Busch in der grotesken Darstellung der Welt des Stückwerks (168f.) kritisiert (1). Dort leben die separaten Körperteile in einer herrschaftlichen Gesellschaft, in der die Hände für die höherstehenden Köpfe und die Füße – gegen Bezahlung – die verschiedenste Arbeit leisten. So schildert Busch, wie bei solcher weitgehenden industriellen Arbeitsteilung der Mensch durch seine sinnentleerte Arbeit von sich selbst entfremdet wird. Die Hoffnungslosigkeit derer, die – in der Nähe einer Stadt mit 'hochrauchenden Schornsteinen' – den Zug zum Wohlstand für immer verpasst haben, steigt aus der folgenden, in ihrer Grausamkeit surrealistisch anmutenden Szene empor: |
|
|
|
Die Tendenz der Heroisierung Das neugegründete Deutsche Reich sehnte sich nach 'großen Persönlichkeiten', die das Machtstreben der einzelnen versinnbildlichen konnten. Busch unterwirft diese Tendenz einer ernüchternden Relativierung. |
|
|
|
Mit 'dem größten Mann seines
Volkes' wird der im März 1890 zurückgetretene Bismarck gemeint sein, der als die große
Persönlichkeit auf Händen getragen wurde, hier aber wie in Buschs Gedicht aus der Kritik
des Herzens als gar nicht 'unentbehrlich' erscheint. Eine ähnliche Bewertung wird den so bewunderten Bürgerdichtern der Zeit zuteil: |
|
|
|
| Eine musterhaftere Illustration des Begriffs 'kulinarische Kunst' ist kaum denkbar. | |
|
Die Liste der kritisierten Elemente ließe sich um ein
Bedeutendes erweitern. Deutlich dürfte jedenfalls geworden sein, dass diese phantastische
Erzählung gar nicht so unabhängig von Zeit und Raum im Leeren schwebt. Es gilt nun, den
kritischen Wert des Werkes in seiner Gesamtheit abzuschätzen. Wir haben die Kritik in Eduards
Traum vorhin als Kritik der Ideologie bezeichnet. Der Begriff hat sich wohl insofern
berechtigt gezeigt, als die angeführten Punkte tatsächlich einen großen Teil des
bürgerlichen Mensch- und Weltbildes von Buschs Zeit kritisieren. Der Begriff der
Ideologiekritik enthält aber noch eine andere Komponente, und zwar das Aufzeigen der
Epochen- und Klassenbedingtheit der herrschenden Ideen. Dies wird jedoch in Buschs
Erzählung nicht realisiert, vielmehr das Gegenteil. Das sog. 'angenehme Kommunalwesen'
(185 ff.), das doch in seiner genossenschaftlichen Gesellschaftsstruktur ein Gegenstück
zu der streng hierarchisch gegliederten Struktur der anderen besuchten Gesellschaften
darstellt, stützt sich nicht auf eine Änderung der Arbeits- und
Produktionsverhältnisse, sondern auf einen medizinischen Eingriff in die körperliche
Verfassung des Menschen. Der menschliche Egoismus und das Machtstreben des Einzelnen, die
in Eduards Traum als Ursache aller Missstände angedeutet werden, sind hier durch
Ausbohrung der 'Konkurrenzdrüse' ("hinter dem einen Ohre, tief in der
Gehirnkapsel") beseitigt worden. Das bedeutet aber, dass nicht die sozialen
Verhältnisse, sondern die in jedem Menschen verankerte Bosheit nach Busch die Mängel in
der Welt bestimmen. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass keine einzige Figur in der
Erzählung – auch nicht der kritische Beobachter Eduard – von Mängeln frei ist. Für das
Wesen der Ideologiekritik hat das schwere Folgen. Jede aufbauende, zielgerichtete Kritik
setzt ja gemeinhin den Glauben an die Veränderbarkeit des Menschen voraus; nur dann
erscheint eine Verbesserung der Strukturen sinnvoll. Dieser Glaube an das Gute im Menschen
fehlt in Eduards Traum; stattdessen herrscht völliger Pessimismus. Der Hinweis auf Buschs Beeinflussung durch Schopenhauer liegt hier nahe. In der Tat können viele Szenen in Eduards Traum als Konkretisierung der schopenhauerschen Philosophie betrachtet werden (2). Das dargestellte Treiben von Zahlen, Punkten, Linien, Figuren, Körperteilen und Menschen lässt sich als Wirkung des alles beherrschenden 'Willens' interpretieren, des unheilbringenden Dranges, der sowohl dem Organischen wie dem Unorganischen eigen ist. Die Grundbeschaffenheit alles Handelns und die Unveränderbarkeit des Menschen (das Böse ist biologisch in ihm verankert) können ebenfalls mit den Ansichten Schopenhauers in Einklang gebracht werden. Man vergleiche nur die folgenden Zitate: "Die Haupt- und Grundtriebfeder im Menschen wie im Tiere ist der Egoismus, d.h. der Drang zum Dasein und Wohlsein [... ] Dieser Egoismus ist im Tiere wie im Menschen mit dem innersten Kern und Wesen desselben aufs genaueste verknüpft, ja, eigentlich identisch." (3) "Der Charakter des Menschen ist konstant. Er bleibt derselbe, das ganze Leben hindurch. [...] Der Mensch ändert sich nie." (4) 
Trotz des nachweisbaren Einflusses enthält Eduards Traum im Paragraphen
beim 'Naturphilosophen' u.a. aber auch eine Parodie auf Schopenhauer und dessen Ideen.
Dabei ist es Busch m.E. jedoch vor allem darum zu tun, die Unerklärbarkeit vieler
Erscheinungen zu zeigen. |
|
|
|
| Es hat sich herausgestellt, dass Buschs Ideologiekritik in Eduards Traum nicht in von seiner Zeit abweichenden politischen oder sozialen Auffassungen, sondern in einer tiefgründigen, pessimistischen Lebensanschauung wurzelt. Busch söhnt die Härte seiner an Nihilismus grenzenden Unzufriedenheit mit den Menschen aus durch das, was er selber Humor nannte, was aber in Wirklichkeit Ironie ist. Für Busch boten 'Humor' und Phantasie die Distanz, die das Leben leidlich machen konnte. Für diejenigen, die in der Welt mehr sahen als "einen nicht unbedeutenden Knödel, durchspickt mit Semmelbrocken" (185), lieferte die Ironie in Eduards Traum genug kritisches Material, um "es jedermann merken (zu) lassen, dass die Bilanzen ein Defizit aufweisen" (201). | |
Anmerkungen * Die arabischen Ziffern zwischen Klammern beziehen sich auf die Seitenzahlen von Eduards Traum in Band IV der Gesamtausgabe, hrsg. v. F. Bohne, Hamburg 1959 (später Wiesbaden). Der Text findet sich auch im Internet: Wilhelm Busch: Eduards Traum (1) Auf gerade diese kritische Funktion der angeführten Stellen hat mich die Busch-Monographie von J. Kraus, Reinbek 1970, S. 135 ff. aufmerksam gemacht. (2) Vgl. J. Ehrlich, Wilhelm Busch der Pessimist. Sein Verhältnis zu Arthur Schopenhauer, Bern 1962, passim. (3) Zit. nach A. Schopenhauer, Welt und Mensch. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk von Arthur Hübscher, Stuttgart 1971, S. 122. (4) a.a.O., S. 128 (5) E. Ackerknecht im Nachwort zur Reclam-Ausgabe von Eduards Traum, Stuttgart 1959, S. 71. |
|
oorspronkelijk verschenen in Wilhelm-Busch-Jahrbuch 1978 (Hannover 1979), p. 68-75 Zu Wilhelm Buschs Leben und Werk: Wilhelm-Busch-Seiten Beitrag über Ludwig Wittgensteins Interesse für Wilhelm Busch und besonders Eduards Traum: http://wittgensteinrepository.org/agora-ontos/article/viewFile/2157/2422 Erik de Smedt |
|
terug naar homepage |